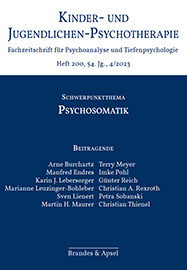Die führende
Fachzeitschrift für
Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse
BESTELLEN
MARIANNE LEUZINGER-BOHLEBER / TERRY MEYER
Pluralismus in der psychoanalytischen Forschung
im Dienste der »dunklen Aufklärung«
Sigmund Freud begründete die Psychoanalyse als eigenständige Wissenschaft des Unbewussten im Sinne einer sogenannten »dunklen Aufklärung«. Nach nun mehr als 100 Jahren sieht sich die psychoanalytische Forschung im 21. Jahrhundert angesichts eines Zeitgeistes, besonders im Bereich der Medizin und der Klinischen Psychologie machtvoll vertretenen, historisch eigentlich längst veralteten Paradigma der Einheitswissenschaften mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Sie begegnet dieser Situation in Zeiten des Pluralismus heutiger Wissenschaften mit einem Reichtum an psychoanalytischen Forschungsansätzen. Wir plädieren dafür, diese Vielfalt auch in Zukunft zu nutzen, um unsere eigene Disziplin selbstkritisch und kreativ weiterzuentwickeln und so im interdisziplinären Dialog an den geistes- und naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Diskurs unseren Beitrag zu den komplexen, bedrängenden Problemen unserer globalisierten Gesellschaft zu leisten.
CHRISTIAN A. REXROTH
Das Wasser wird knapper:
Tröpfchenbewässerung statt Gießkannenprinzip –Weckruf für eine kindeswohlgeleitete Willkommenskultur
und eine familienmedizinische Versorgung
Der Beitrag skizziert die Entwicklung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien in Deutschland über die COVID-19-Pandemie in die Gegenwart und fokussiert auf die gesundheitsbezogenen Veränderungen. In diesem Kontext erscheint die schon präpandemisch bestehende Diskrepanz zwischen Bedarfen und Angeboten der psychosomatischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen ebenso deutlich wie die stetige Zunahme der Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendhilfe.
Die Änderung gesellschaftlicher Strukturen und die immer größer werdenden Nöte von Kindern und Jugendlichen auch im Hinblick auf ihre Zukunft lassen den Autor u. a. für eine grundgesetzliche Verankerung der UN-Kinderrechte sowie für eine Normenkontrolle für die analoge und digitale Welt plädieren.
Zuletzt greift der Beitrag wesentliche gesundheitspolitische Entscheidungen der Gegenwart im Hinblick auf die Versorgung psychisch Belasteter auf, wirbt für einen familienmedizinischen Versorgungsansatz und sieht eine kindeswohlgeleitete Willkommenskultur als notwendige paradigmatische Grundlage für eine Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen.
ARNE BURCHARTZ
Frühe Deprivation und Enuresis
Ein kasuistischer Beitrag
Der Beitrag untersucht anhand eines ausführlichen Fallbeispiels den Zusammenhang zwischen der traumatischen Erfahrung der frühkindlichen Deprivation und dem psychosomatischen Bewältigungsversuch durch eine Exkorporation in dem Symptom der Enuresis.
Es wird die zentrale These dargelegt, dass sich in der Resomatisierung das Scheitern der psychischen Repräsentanzenbildung darstellt. Der Prozess der »Psychisierung« somatisch gebundener Konfliktverarbeitung, eine Kernaufgabe der Therapie, wird anhand der Psychodynamik des Übertragungsgeschehens in der Analyse nachgezeichnet.
GÜNTER REICH
Essstörungen
Essstörungen sind in der Regel schwerwiegende psychosomatische Erkrankungen, die sich auf der psychischen, physiologischen und interpersonellen Ebene entwickeln und ein ausgeprägtes Chronfizierungspotenzial haben. Psychoanalytische und psychodynamische Therapie haben in ihrer Behandlung eine lange Tradition.
Soziale, psychodynamische und familiendynamische Aspekte sowie Besonderheiten der störungsorientierten psychodynamischen Psychotherapie werden beschrieben. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf die Anorexia und Bulimie nervosa und bezieht die Binge Eating Störung mit ein.
Eine Fallskizze einer Anorexie-Behandlung rundet die Darstellung ab.
IMKE POHL
Rätsel Anorexie – »Darf ICH sein?«
Der Beitrag befasst sich mit dem komplexen Krankheitsbild der Anorexia nervosa vor dem Hintergrund der analytischen Langzeittherapie einer spätadoleszenten Patientin und geht der Frage nach, welche Parameter als Orientierung für eine prognostische Einschätzung hilfreich und aussagekräftig sein können und wann mit einer Chronifizierung zu rechnen ist.
Besondere Beachtung wird dabei den unterschiedlichen psychodynamischen Hintergründen der oft dramatischen Gewichtsabnahme (Abmagerung) gewidmet, um das Rätsel Anorexie besser zu verstehen.
ei dem vorgestellten Fall geht es um eine transgenerationale Traumaweitergabe mit der Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsorganisation in der Folge.
KARIN J. LEBERSORGER
Ich spreche mit meinem Körper –
Psychodynamik der Essstörungen
bei Menschen mit Down–Syndrom
Essstörungen von Menschen mit Down-Syndrom werden häufig nicht als Somatisierung ihres psychischen Befindens verstanden, sondern als Resultat ihrer chromosomalen Besonderheit. Sie beginnen meist im Jugendalter und stellen eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und Lebensqualität dar.
Psychodynamisch betrachtet finden sich neben syndromspezifischen Herausforderungen besondere Entwicklungsbedingungen, die die Somatisierung psychisch unrepräsentierter Zustände und unintegrierter Affekte begünstigen.
So führen präoperationale medizinische Traumatisierung verbunden mit Verlusterlebnissen, regelmäßige gesundheitserhaltende Untersuchungen, geringe Mentalisierungsfähigkeit sowie ein Mangel an Unterstützung bei der Bewältigung adoleszenter Krisen vielfach zur Regression auf die orale Ebene. Auf dieser libidinösen Entwicklungsstufe werden die seelischen Nöte von Verweigerung über Spannungsabfuhr bis Lustgewinn körpersprachlich dargestellt.
Ein interdisziplinäres Lebensstilprojekt für junge Erwachsene mit Adipositas wird vorgestellt, das die psychische Dimension mittels Gruppengesprächen erfolgreich integrierte.
SVEN LIENERT / PETRA SOBANSKI / MANFRED ENDRES / CHRISTIAN REXROTH
Schulabsentismus – Strategien in
der ärztlichen und therapeutischen Praxis
Ist schulvermeidendes Verhalten eine Folge der Pandemie und anderer Krisenerfahrungen? Lässt sich ein Zusammenhang feststellen? Genaue Fallzahlen liegen dazu nicht vor, die längere Abwesenheit von Schüler*innen vom Unterricht wird in Deutschland größtenteils kaum dokumentiert.
Schulabsentismus ist einerseits immer unter psychosomatischen Gesichtspunkten zu betrachten und bezieht sich auf die Wechselwirkung zwischen psychischen Faktoren (z. B. Emotionen, Gedanken, Stress) und körperlichen Symptomen oder Erkrankungen; andererseits ist Schulabsentismus wie eine Infektion mit »42 Grad Fieber« zu sehen und bedarf einer intensivierten Behandlung. Erfolgreiche Konzepte zur Verbesserung orientieren sich situativ an den Gegebenheiten und unter Integration aller mit der jeweiligen Situation Befassten.
Empfohlen wird von Beginn an ein multiprofessionelles Behandlungsmodell; hierzu gehört auch die standardisierte und transparente Erfassung der bekannten Fehlzeiten. Pragmatisch bedeutet dies, dass analog auf einem schul(-form-)übergreifend einheitlichen Formular ärztlich bzw. therapeutisch mittels Stempel und Unterschrift der Zeitrahmen für die Schulbefreiung attestiert wird.
Auf diesem Vordruck sollte dann bereits die Anzahl der in der Schule dokumentierten Fehltage in der jeweils aktuellen Fassung vorliegen. Dabei ist entscheidend, dass keine Atteste durch mit der Symptomatik nicht vertrauten bzw. erfahrene Behandler*innen ausgestellt werden.
Zusätzlich wird im nachfolgenden Artikel kritisch der Vergabe einer »symptomatischen« Diagnose gemäß ICD-10 bzw. -11 diskutiert, mit dem Ziel einer Erfassung der komplexen Symptomatik, aber auch zur frühen Identifikation.
CHRISTIAN THIENEL
»Irgendwie tut etwas weh,
aber es gibt keinen Grund.«Unspezifische Körperbeschwerden in der analytischen
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Beispiel
von Schlafstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen
Der vorliegende Beitrag zur Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters befasst sich mit einer Gruppe häufig auftretender unspezifischer Beschwerden: Schlafstörungen sowie Kopf- und Bauchschmerzen.
Diese Körpersymptome sind insofern unspezifisch, als sie sich multivalent präsentieren und sich meistens zu keinem eigenen Krankheitsbild formieren. Stattdessen kommt ihnen ein verweisender Charakter auf eine erhöhte bio-psychische Belastung des Kindes bzw. des Jugendlichen zu, deren Hintergründe durch die psychotherapeutische Behandlung erkennbar werden können.
Die vorgestellten Fallbeispiele veranschaulichen die Bandbreite möglicher Ursachen und erörtern das Zusammenspiel von Körper und Psyche aus psychodynamischer Sicht. Dabei kommt der Einbettung in das Hier und Jetzt der psychosomatischen Situation besondere Bedeutung zu.
MARTIN H. MAURER
Somato-psychische Fallvignetten
zur Bedeutung der Konsiliaruntersuchung
vor Psychotherapie
Am Beispiel zweier Fallvignetten soll auf die Bedeutung und Notwendigkeit einer körperlichen Untersuchung vor Aufnahme einer psychotherapeutisch-psychiatrischen Behandlung hingewiesen werden, auch im Zusammenhang der obligatorischen Konsiliaruntersuchung im Rahmen der Richtlinien-Psychotherapie.
Im ersten Fallbeispiel wird von einer 16-jährigen Patientin mit anorektischer Symptomatik berichtet, im zweiten Fallbeispiel von einem zwölfjährigen Patienten mit frühkindlichem Autismus und schweren Selbstverletzungen. In beiden Fällen lagen somatische Ursachen den Verhaltensstörungen zugrunde. Diese wären ohne körperliche Untersuchung nicht erkannt worden und es wäre in beiden Fällen eine langwierige und vermutlich erfolglose psychotherapeutisch-psychiatrische und ggf. medikamentöse Behandlung erfolgt.
In beiden Fällen hätte die Behandlung die Patientin und den Patienten erheblich geschädigt und gefährdet. Wenn auch jeweils seltenere somatische Ursachen zugrunde lagen, sind diese doch im Zusammenhang somato-psychischer und psycho-somatischer Zusammenhänge zu verstehen.